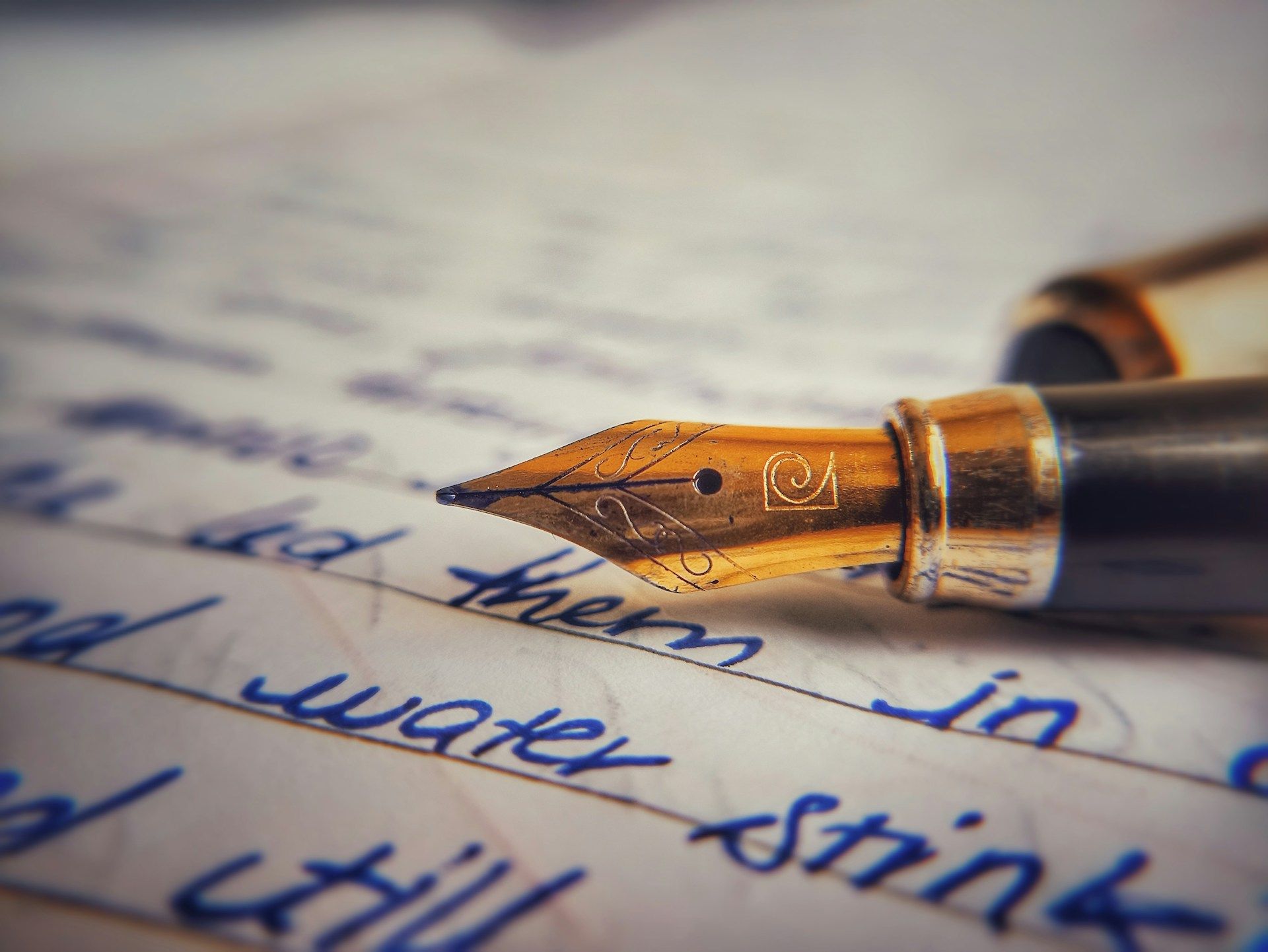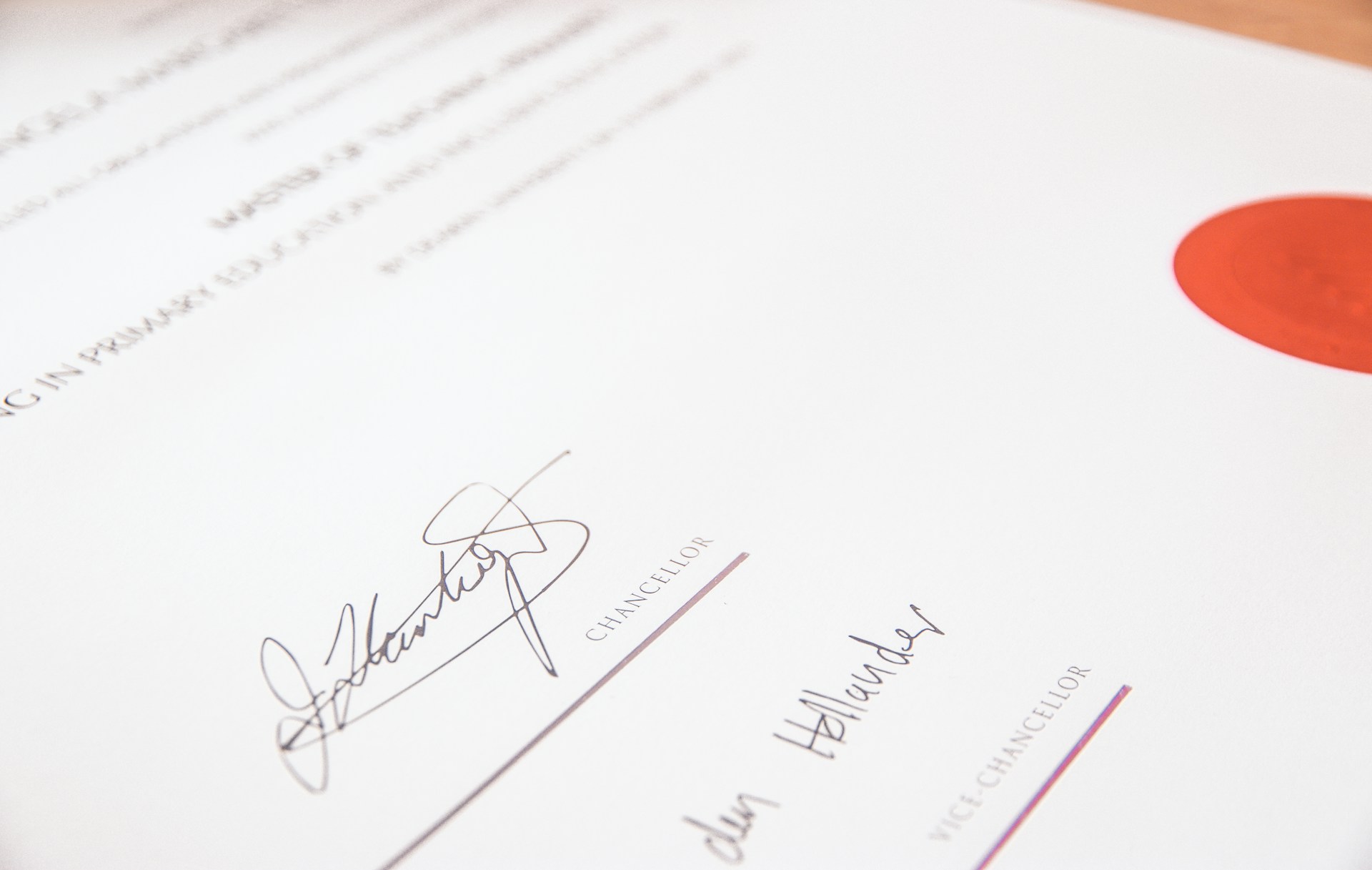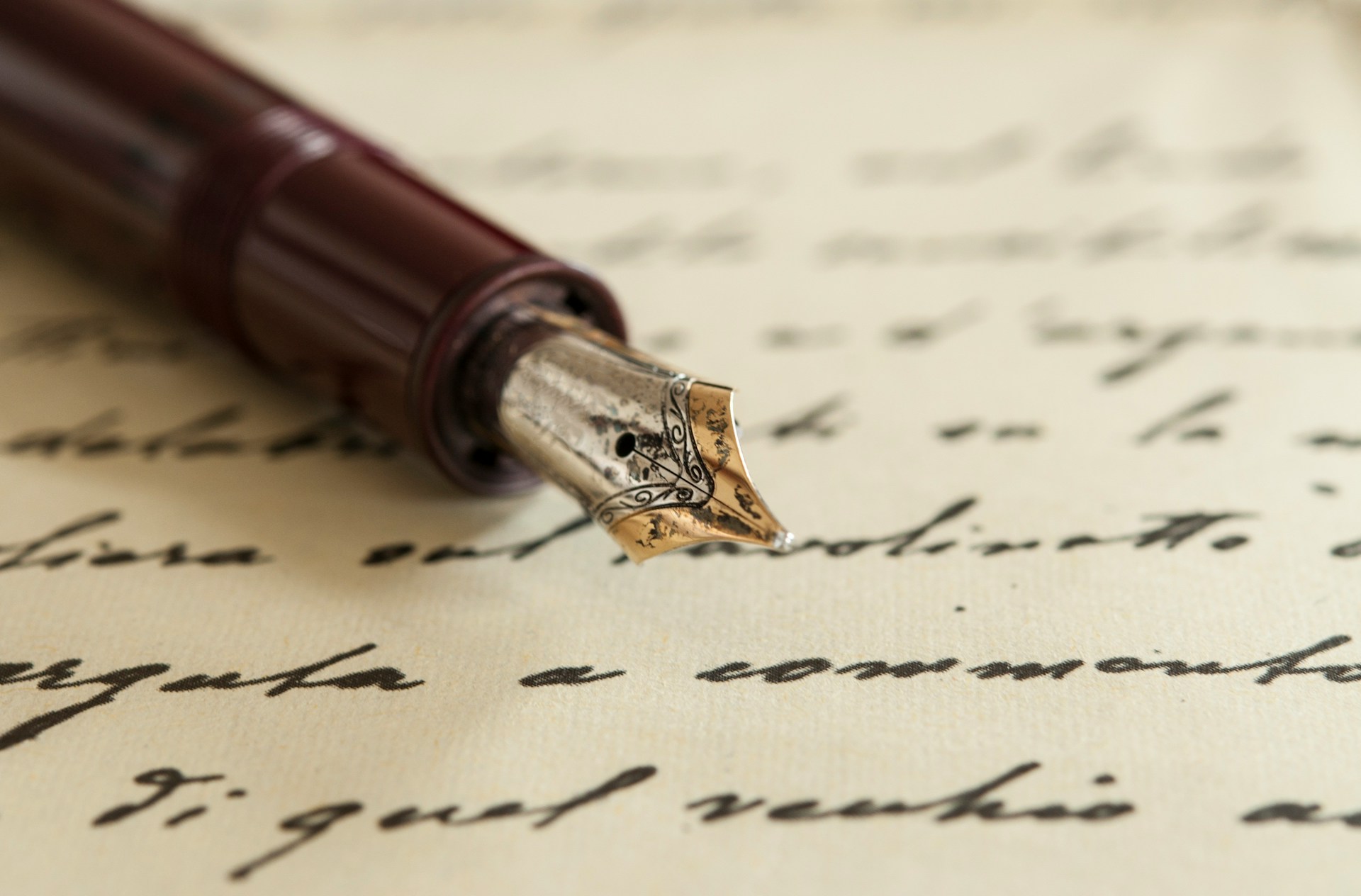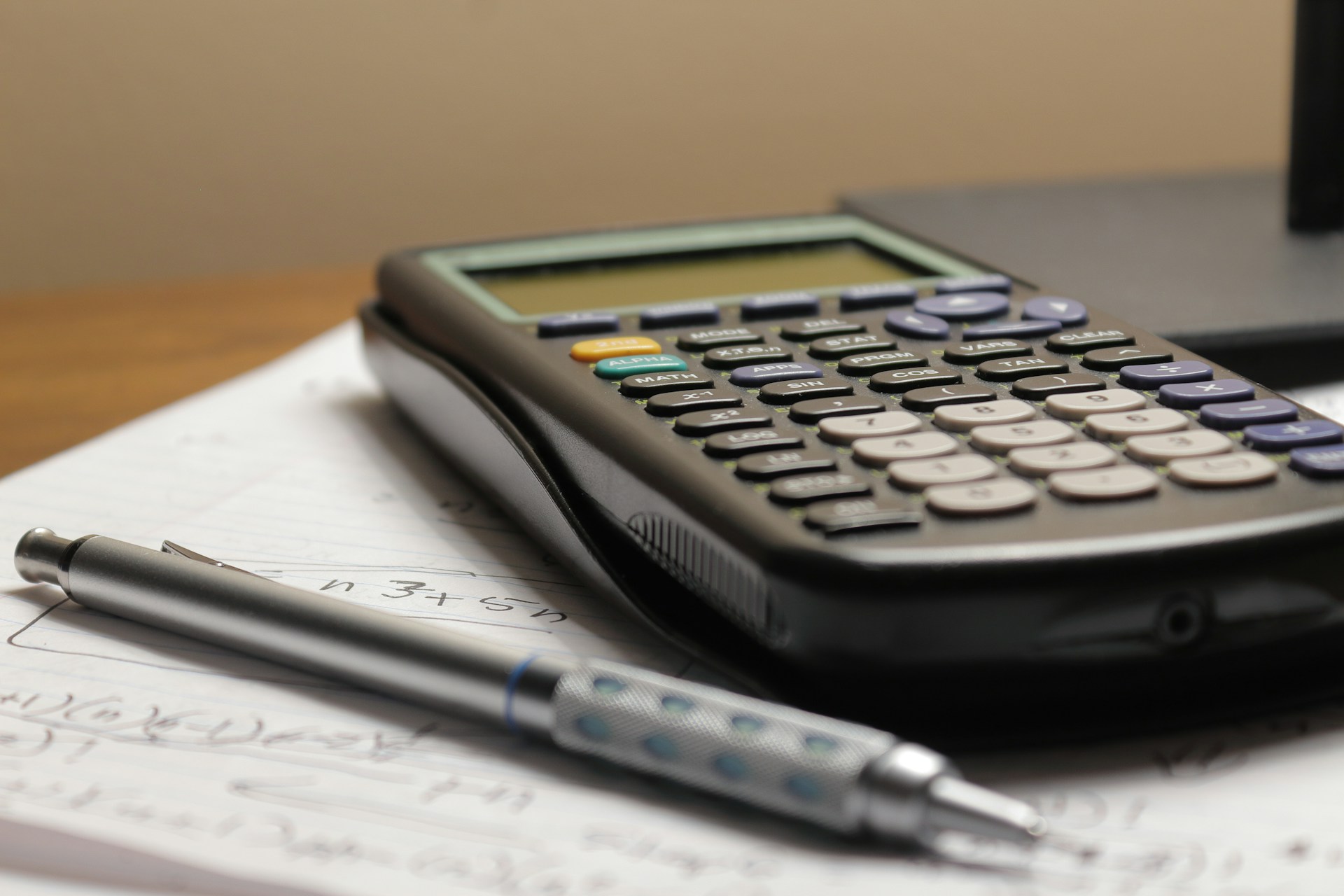Immobilien kaufen mit Köpfchen: Ihr Leitfaden für den Thurgau
Wie Sie erkennen, ob ein Haus seinen Wert hält – und was eine gute Investition ausmacht
Ein Eigenheim im Thurgau kann eine solide und zukunftssichere Investition sein – vorausgesetzt, die Immobilie behält ihren Wert, oder steigert ihn sogar. Doch woran erkennen Sie, ob ein Haus tatsächlich wertstabil ist?
Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, worauf es dabei ankommt. Wir zeigen, welche Faktoren, den Immobilienwert beeinflussen – verständlich, praxisnah und auf die Besonderheiten des Thurgauer Markts abgestimmt.
Ob Sie das Haus selbst bewohnen oder als Anlageobjekt kaufen möchten: Hier finden Sie konkrete Tipps zur Einschätzung von Lage, Substanz, rechtlicher Sicherheit und Marktentwicklung. Praxisbeispiele aus der Region und aktuelle Zahlen helfen Ihnen, eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Andere Kategorien
Haus kaufen mit Blick auf die Lage: So erkennen Sie wertvolle Immobilien
Die Regel „Lage, Lage, Lage“ gilt auch – und besonders – in der Schweiz. Wer eine Immobilie kauft, entscheidet sich immer auch für den Standort. Dabei lohnt sich der Blick auf zwei Ebenen: die Region (Makrolage) und das unmittelbare Wohnumfeld (Mikrolage). Nur wenn beides überzeugt, sichern Sie sich langfristigen Werterhalt und Entwicklungspotenzial.
Die Makrolage beschreibt die Gemeinde und ihre Einbettung in die Region. Besonders attraktiv sind Orte mit wirtschaftlicher Perspektive, stabiler Infrastruktur, guter Anbindung an Städte wie Zürich, Winterthur oder St. Gallen – und einer wachsenden Bevölkerung.
Genau diese Merkmale zeichnen viele Gemeinden im Thurgau, etwa Frauenfeld, Kreuzlingen oder die Seegemeinden am Bodensee aus. Ihre Nähe zum Wirtschaftsraum Zürich und die vergleichsweise moderaten Preise machen sie für Pendler wie Familien interessant. Abgelegene Dörfer mit schlechter Erreichbarkeit und wenigen Entwicklungschancen verlieren dagegen an Nachfrage – und damit an Wert.
Die Mikrolage betrifft das direkte Wohnumfeld. Wie ruhig liegt die Strasse? Sind Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und öffentliche Verkehrsmittel gut erreichbar? Wie wirkt das Quartier – gepflegt, lebendig, sicher? Auch Faktoren wie Grünflächen, Sonneneinstrahlung und Fernsicht spielen eine Rolle.
Machen Sie sich selbst ein Bild: Spazieren Sie morgens und abends durch die Umgebung, achten Sie auf Geräusche, Gerüche und das allgemeine Gefühl. Wenn Sie sich dort sofort wohlfühlen, ist das ein gutes Zeichen.
Wertstabile Immobilien finden Sie dort, wo Menschen gerne leben. Der Kanton Thurgau verzeichnet seit Jahren ein konstantes Bevölkerungswachstum – ein klares Signal für solide Nachfrage. Vor allem Gemeinden mit vielen Familien, attraktiven Schulen und guter Infrastruktur entwickeln sich stabil. Prüfen Sie deshalb auch die Altersstruktur und Bevölkerungsstatistiken der Gemeinde. Steigende Zahlen sprechen für Potenzial – sinkende eher für Zurückhaltung.

Der Zustand entscheidet: Wann sich eine Immobilie als Investition auszahlt
Neben der Lage spielt der bauliche Zustand eine entscheidende Rolle für die Wertstabilität einer Immobilie. Ein Haus mit massiver Bauweise, gutem Dach, trockenen Wänden und intakter Haustechnik bleibt langfristig attraktiv – besonders dann, wenn Eigentümer es laufend instandgehalten haben. Wer etwa regelmässig Fenster, Heizung, Fassade oder Leitungen erneuert, verhindert Sanierungsstau und erhält den Wert.
Besonders wichtig ist heute die Energieeffizienz. Sie entscheidet nicht nur über die laufenden Nebenkosten, sondern zunehmend auch über den Marktwert – und darüber, wie leicht sich das Haus verkaufen oder finanzieren lässt.
Ein Beispiel: Ein schlecht gedämmtes Haus aus den 1980er-Jahren mit Ölheizung und Einfachverglasung verbraucht schnell 20 Liter Heizöl pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr. Bei 150 m² Wohnfläche entspricht das 3’000 Litern Öl – aktuell rund CHF 0.95 pro Liter. Die jährlichen Heizkosten betragen also rund CHF 2’850. Dazu kommen noch Strom und Wasser.
Ein modernisiertes Haus mit guter Dämmung, Wärmepumpe und Photovoltaikanlage schafft denselben Wohnkomfort mit weniger als der Hälfte der Energie. Die Heizkosten liegen dann oft unter CHF 1’200 im Jahr – bei gleichzeitig höherem Wohnwert, besserem Raumklima und geringerer Abhängigkeit von Energiepreisen. Das spart nicht nur laufend Geld, sondern verbessert auch die Einstufung im Energieausweis.
Der sogenannte GEAK (Gebäudeenergieausweis der Kantone) zeigt, wie energieeffizient ein Haus wirklich ist – von A (sehr effizient) bis G (sehr ineffizient). Käufer, Banken und Förderstellen achten zunehmend auf diese Bewertung. Ein Haus mit Klasse A oder B lässt sich meist einfacher verkaufen, besser finanzieren und günstiger versichern.
Sie haben Fragen zum Thema Finanzierung? Alle Antworten finden Sie hier: Finanzierung des Eigenheims im Thurgau: Ihre Optionen im Überblick.
Immobilien kaufen ohne Risiko: Was Sie rechtlich beachten sollten

Wertstabile Immobilien haben eine rechtlich klare Ausgangslage. Das bedeutet: Es gibt keine offenen Fragen oder Unsicherheiten, die später teuer oder kompliziert werden könnten. Bevor Sie ein Haus kaufen, sollten Sie deshalb genau prüfen, ob die rechtlichen Rahmenbedingungen stimmen.
Zunächst ist wichtig, ob das Grundstück in einer regulären Wohnzone liegt. In der Wohnzone dürfen Sie dauerhaft wohnen, meist sind auch Umbauten oder Erweiterungen möglich. Steht das Haus aber in einer Landwirtschaftszone oder einer Spezialzone, kann es sein, dass gar nicht dauerhaft gewohnt werden darf oder dass strenge Einschränkungen für Umbauten gelten. Solche Lagen sind meist weniger gefragt – und damit auch weniger wertstabil.
Ein weiterer Punkt ist das Eigentumsverhältnis. Besonders in der Schweiz gibt es neben dem Volleigentum auch sogenannte Baurechtsobjekte. Das bedeutet: Das Gebäude gehört Ihnen, aber der Boden darunter nicht. Dafür zahlen Sie einen jährlichen Baurechtszins.
Solche Objekte sind zwar oft günstiger in der Anschaffung, verlieren aber mit ablaufendem Baurechtsvertrag an Wert. Wenn der Vertrag nur noch wenige Jahre läuft oder unsichere Verlängerungsbedingungen hat, kann das den Wiederverkauf erschweren.
Auch Einträge im Grundbuch können eine Rolle spielen. Vielleicht gibt es sogenannte Dienstbarkeiten, also Rechte, die andere Personen auf Ihrem Grundstück haben. Ein typisches Beispiel ist ein Wegrecht: Ein Nachbar darf Ihr Grundstück überqueren, um zu seinem Haus zu gelangen. Solche Einträge sind nicht unbedingt problematisch, sollten aber bekannt sein – vor allem, wenn sie den Garten, die Zufahrt oder geplante Umbauten betreffen.
Kritisch wird es bei Altlasten, also wenn etwa früher eine Werkstatt oder eine Tankstelle auf dem Grundstück stand. In solchen Fällen kann es sein, dass der Boden verunreinigt ist und eine teure Sanierung nötig wird. Der Kanton führt dazu ein Altlastenverzeichnis, das eingesehen werden kann.
Ebenfalls wichtig: Wurden alle Umbauten korrekt bewilligt? Ein Anbau ohne Baubewilligung kann später zu Problemen führen – etwa, wenn die Gemeinde einen Rückbau fordert oder die Bank wegen fehlender Legalität nicht finanziert. Das kann auch den Wiederverkauf erschweren.
Darüber hinaus lohnt sich ein Blick auf geplante Veränderungen in der Umgebung. Ein schönes Haus mit Blick ins Grüne verliert an Wert, wenn auf der Wiese gegenüber bald ein grosser Wohnblock entsteht. Viele Gemeinden veröffentlichen Informationen zu laufenden oder geplanten Projekten – etwa im Richtplan oder Baugesuchverzeichnis.
Zusätzlich gibt es einige nationale Regeln, die für den Immobilienmarkt relevant sind. So begrenzt die sogenannte Lex Weber in touristischen Gemeinden den Anteil an Zweitwohnungen auf maximal 20 Prozent. Wer ein Ferienhaus kaufen möchte, sollte also genau prüfen, ob das in der Gemeinde überhaupt noch erlaubt ist.
Immobilienpreise im Thurgau: Gute Gründe, jetzt ein Haus zu kaufen
Der Immobilienmarkt im Thurgau hat sich in den letzten Jahren solide entwickelt – und das ganz ohne die überhitzten Preissprünge, wie man sie aus städtischen Zentren kennt. Derzeit liegt der Medianpreis für Einfamilienhäuser bei etwa CHF 1.228.500. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis beträgt rund CHF 7.226.
Damit ist der Thurgau im Vergleich zu Regionen wie Zürich, wo ähnliche Objekte schnell über vier Millionen Franken kosten können, deutlich günstiger.
Im Jahr 2024 verzeichneten die Preise einen moderaten Anstieg von 1,2 Prozent. Für 2025 rechnen Marktbeobachter mit einem Wachstum von rund 3 Prozent. Das zeigt: Der Markt bleibt in Bewegung – aber auf gesunder Grundlage.
Der Thurgau gilt daher als verlässlicher Standort mit Entwicklungspotenzial. Wer hier investiert, setzt nicht auf kurzfristige Gewinne, sondern auf Stabilität und Substanz. Genau das macht den Kanton interessant – besonders in wirtschaftlich unruhigen Zeiten.
Mehr als eine Investition: Finden Sie das Zuhause, das zu Ihnen passt
Eine Immobilie ist nicht nur eine Investition, die sich rechnen soll. Sie ist auch Ihr Zuhause. Ein Ort, an dem Sie ankommen, aufatmen und sich rundum wohlfühlen möchten.
Deshalb zählt nicht nur, was auf dem Papier gut aussieht – sondern auch, was sich richtig anfühlt. Vielleicht erfüllt ein Haus alle objektiven Kriterien, aber etwas stimmt für Sie nicht – hören Sie auf Ihr Bauchgefühl.
Wenn Sie Ihr Traumhaus gefunden haben, beginnt die eigentliche Arbeit: prüfen, vergleichen, bewerten. Die wichtigsten Informationen dafür haben Sie jetzt an der Hand. Und wenn Sie auf dem Weg dorthin Unterstützung brauchen, helfen wir Ihnen gerne.
Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Region unterstützen wir Sie, die richtige Entscheidung zu treffen – schreiben Sie uns einfach.